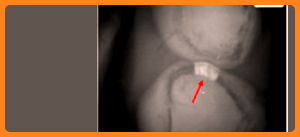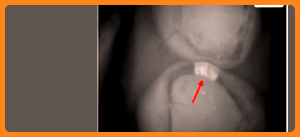Präventiv vs. reparativ – Wohin steuert die Zahnmedizin in Industrieländern?
Hintergrund und Problemstellung
Orale Erkrankungen sind weitgehend vermeidbar, dennoch sind viele zahnmedizinische Versorgungssysteme in Industrieländern überwiegend kurativ ausgerichtet und konzentrieren sich auf die „Reparatur“ von Zahnschäden . So entfällt der Großteil der jährlichen Ausgaben (z. B. ~€79 Mrd. in der EU) auf restaurative Behandlungen . Karies, Parodontitis und Zahnverlust wären durch bewährte Präventionsmaßnahmen eigentlich verhütbar . Trotz deutlicher Erfolge der Prophylaxe – etwa stark gesunkene Kariesraten bei Kindern – besteht weiterhin enormes Verbesserungspotenzial: Nach wie vor besteht ein Großteil der täglichen Arbeit in Zahnarztpraxen in schlichter Reparatur vermeidbarer Defekte . Dieses traditionell interventionistische Paradigma der Zahnheilkunde wird zunehmend kritisch gesehen, da es die Ursachen oraler Erkrankungen unzureichend adressiert und soziale Ungleichheiten in der Mundgesundheit fortbestehen lässt .
Aktuelle Analysen fordern deshalb einen Paradigmenwechsel hin zu einer präventionsorientierten „oralen Medizin“, die Mundgesundheit fördert statt nur Krankheit zu behandeln . Im Folgenden werden systemische, strukturelle und wirtschaftliche Ursachen der reparativ dominierten Zahnmedizin untersucht – einschließlich Finanzierungsanreizen, Industrieeinflüssen, Ausbildung und Berufspolitik sowie Patientenverhalten. Ein internationaler Vergleich (Deutschland, Skandinavien, USA, UK, Japan) zeigt Unterschiede und erfolgreiche Präventionsmodelle auf. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Literaturrecherche (1970–2025) in PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, ScienceDirect und ResearchGate, einschließlich unabhängiger Studien hoher methodischer Qualität (systematische Reviews, RCTs, Langzeitstudien). Jeder Quellenbeleg wird hinsichtlich Design, Stichprobe, Transparenz und möglicher Bias analysiert, abschließend bewertet (Ampelsystem) und kommentiert.
Finanzielle Anreize und Vergütungssysteme
Ein zentrales systemisches Hemmnis für Prävention sind vergütungsbezogene Fehlanreize im Gesundheitswesen. In vielen Ländern dominieren Fee-for-Service-(FFS)-Systeme, bei denen jede Behandlung einzeln bezahlt wird – was ökonomisch vor allem invasive Leistungen belohnt, nicht jedoch Beratung oder Prävention . Die Konsequenz: Mehrleistungen („overtreatment“) werden im FFS-System begünstigt , während präventive Maßnahmen mangels Honorierung oft unterbleiben. Im Gegensatz dazu können kapitationsbasierte oder pauschale Modelle Anreize für Gesunderhaltung setzen, indem der Zahnarzt ein fixes Budget pro Patient erhält – und also profitiert, wenn weniger behandelt werden muss . Allerdings besteht hier die Gefahr von Unterbehandlung (Verzicht auf notwendige Therapie, um Kosten zu sparen) . Ein Cochrane-Review (EPOC) identifizierte nur zwei kontrollierte Studien aus UK zu diesem Thema: Unter Kapitation sahen Zahnärzte die Patienten seltener, führten weniger Füllungen/Extraktionen durch und gaben häufiger präventive Empfehlungen – hingegen steigerte FFS die Zahl der Eingriffe . Wichtig ist, dass die Zahnärzte im Kapitationsarm Kariesläsionen später und zurückhaltender invasiv behandelten (d. h. zunächst abwarteten oder non-invasive Maßnahmen nutzten) als die FFS-Kontrollgruppe . Obwohl die Evidenzbasis begrenzt war (nur 2 Studien, niedrige Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse) , unterstreichen diese Befunde das Prinzip: Vergütung beeinflusst das zahnärztliche Verhalten maßgeblich .
In vielen Industrieländern wird dieser Zusammenhang deutlich. Deutschland etwa hat in der GKV zwar feste Gebührensätze je Leistung und teilweise Bonusanreize für regelmäßige Vorsorge (Bonusheft: höhere Erstattung bei Zahnersatz nach jährlich wahrgenommenen Kontrolluntersuchungen), jedoch bleibt die Vergütung primär pro Behandlung. Präventive Leistungen wie professionelle Zahnreinigungen sind für Erwachsene meist Privatleistung. Das honoriert Reparatur mehr als Prävention . Großbritannien reformierte sein NHS-Zahnsystem 2006: Weg vom reinen FFS hin zu sogenannten „Units of Dental Activity“ (Mischmodell aus Pauschalen und Leistungszählern) – mit begrenztem Erfolg. Viele Zahnärzte kritisieren weiterhin, dass präventive Beratung im aktuellen UDA-System nicht adäquat vergütet wird. Skandinavische Länder wie Dänemark oder Schweden finanzieren hingegen umfangreiche öffentliche Prophylaxeprogramme für Kinder (Schulzahnpflege) und nutzen häufiger Gehälter oder Capitation im öffentlichen Sektor . In Dänemark z. B. sind Kinderzahnpflege bis 18 J. kommunal organisiert und kostenlos, was flächendeckende Vorsorge ermöglicht. USA: Hier dominieren privatwirtschaftliche FFS-Strukturen; private Versicherer decken zwar i. d. R. Kontrolluntersuchungen und Dentalhygiene ab (um teure Folgeschäden zu vermeiden), doch wer un- oder unterversichert ist, geht oft erst bei Schmerzen zum Zahnarzt. So entsteht ein Kreislauf aus akuten Reparaturbehandlungen statt kontinuierlicher Prävention, verstärkt durch die wirtschaftlichen Anreize des FFS-Systems und Produktivitätsdruck in vielen Praxen . Japan bietet ein interessantes Paradoxon: Die universelle Krankenversicherung deckt zahnärztliche Behandlungen (Füllungen, Kronen, Extraktionen etc.) großteils ab, jedoch nur eingeschränkt präventive Leistungen . Folge: Kurative Versorgung ist in Japan allgemein verfügbar, doch präventive Zahnarztbesuche bleiben rar – nur ~24–34 % der Erwachsenen nutzen jährliche Prophylaxe, v. a. Besserverdienende . Geringere Inanspruchnahme von Prävention wird hier direkt auf die Finanzierungslogik zurückgeführt: Bei limitierten öffentlichen Mitteln für Prävention fließen Ressourcen bevorzugt in Behandlung, Prävention erscheint weniger prioritär . Selbst in Ländern mit Präventionsprogrammen zeigt sich dieser Effekt – z. B. hatten Irland und Spanien (ohne umfassende Kassenleistung für Kinderzahnvorsorge) bis in die 2010er suboptimalen Präventionsfokus, während Länder mit universeller Abdeckung (DK, DE, UK/Schottland) eher präventive Erweiterungen umsetzten .
Zusammengefasst: Viele Gesundheitssysteme belohnen bislang das „Bohren und Füllen“ stärker als das Verhindern von Krankheiten . Experten fordern daher, Vergütungssysteme umzubauen, sodass Prävention und Erhalt der Mundgesundheit finanziell attraktiver werden . Ideen sind z. B. Pay-for-Prevention-Modelle, Bonuszahlungen für nachgewiesene Kariesreduktion oder hybride Systeme. Solche Ansätze stehen jedoch noch am Anfang und erfordern weitere Forschung sowie politischen Willen.
Einfluss der Dentalindustrie auf Forschung und Versorgungspraxis
Die Rolle der Industrie – sowohl der dentalen Industrie (Hersteller von Materialien, Instrumenten, Medizinprodukten) als auch angrenzender Branchen wie der Zucker- und Ernährungsindustrie – ist ein kritischer, oft unterschätzter Faktor. Kommerzielle Interessen können subtile Anreize schaffen, die den Schwerpunkt der Zahnmedizin beeinflussen.
Ein aufschlussreiches Beispiel ist der historische Einfluss der Zuckerindustrie auf die Ausrichtung der Kariesforschung. Interne Dokumente aus den 1960/70er Jahren zeigen, dass die Zuckerwirtschaft in den USA aktiv auf das National Institute of Dental Research (NIDR) einwirkte, um den Fokus des nationalen Kariesforschungsprogramms weg von präventiven Ernährungsmaßnahmen zu verschieben . Da der Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Karies wissenschaftlich unbestreitbar war, verfolgte die Industrie eine Deflektionsstrategie: Statt Zuckerreduktion sollten technische Lösungen erforscht werden – z. B. Enzyme zur Plaque-Zersetzung oder eine Karies-Impfung . Die Zuckerlobby finanzierte entsprechende Studien, platzierte Experten in Beratungsgremien und beeinflusste die Förderagenda, sodass 1971 ein Forschungsprogramm aufgelegt wurde, das vorrangig solche „technologischen“ Interventionen verfolgte . 78 % der industriegesteuerten Empfehlungen fanden Eingang in den ersten öffentlichen Forschungsaufruf des NIDR-Programms . Die Folgen dieser Einflussnahme: Maßnahmen zur Reduktion des Zuckerverzehrs traten in den Hintergrund, während die Zahnmedizin in den Folgejahrzehnten auf Bohrung, Füllungsmaterialien und andere Symptom-Behandlungen setzte – eine Richtung, von der die Zucker- und Lebensmittelindustrie profitierte . Erst in jüngerer Zeit rücken „Sugar Policies“ (z. B. Zuckersteuern, Verbrauchsaufklärung) wieder ins Blickfeld, begleitet von der Forderung nach strikten COI-Richtlinien (Conflict of Interest), um industriegetriebene Verzerrungen in Forschung und Politik offenzulegen . So betont eine Lancet-Kommission 2019, dass die Zahnpflege-Organisationen und Forschung vor kommerziellen Einflüssen (insb. der Zuckerindustrie) besser geschützt und Transparenzregeln verschärft werden müssen .
Neben der Zuckerindustrie spielt auch die Dental-Branche selbst eine Rolle. Hierzu zählen Hersteller von Füllungsmaterialien, Implantaten, Geräten für Praxis und Labor sowie kommerzielle Laborketten. Deren Geschäftsmodell basiert auf Absatz von Produkten, die vor allem in der kurativ/restaurativen Zahnmedizin Verwendung finden (Bohrer, Füllstoffe, Kronen, Implantate etc.). Eine präventionsorientierte Versorgung – bei der etwa initiale kariöse Läsionen durch Fluoridierung inaktiviert statt aufgebohrt würden – reduziert den Bedarf an umfangreichen Restaurationen und damit potenziell den Umsatz bestimmter Industriezweige. Zwar investieren viele Hersteller auch in präventive Produkte (z. B. Fluoridzahnpasten, Fissurenversiegler, Kariesdetektoren), doch insgesamt fließen erhebliche Mittel in die Vermarktung neuer Technologien für die Intervention (z. B. CAD/CAM für Kronen, hochpreisige Implantatsysteme). In der Forschung zeigt sich dies teils in der Sponsoring-Landschaft: Studien zu neuen Materialien oder Geräten werden häufig industriell unterstützt, während Public-Health-Forschung (etwa zur Gesundheitsförderung) oft weniger finanzielle Förderung erhält. Einer Scoping-Review von 2024 zufolge weisen über 32 % der untersuchten Publikationen in der Zahnmedizin keine klare Offenlegung von Interessenkonflikten auf – Transparenz ist also noch ausbaufähig. In nur ca. 38 % der Dental-Metaanalysen wird überhaupt ein COI-Statement angegeben (davon berichteten 8 % tatsächlich bestehende Interessenkonflikte) . Die Tendenz ist zwar steigend (nach 2009 häufiger Disclosure) , doch diese Zahlen deuten an, dass Industriebeziehungen oft unzureichend offengelegt werden. Positiv zu vermerken: Wenn klare Richtlinien existieren, befolgen Dentalwissenschaftler diese meist gewissenhaft – d. h. es fehlt weniger am Willen als an verbindlichen Vorschriften.
In der Versorgungspraxis manifestiert sich Industrieeinfluss auch durch Kommerzialisierungstendenzen. Beispiel: die Korporatisierung der Zahnmedizin („Dental Chains“). In Ländern wie den USA oder zunehmend auch Europa kaufen Investoren Zahnarztpraxen auf und führen sie nach betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Zahnärzte berichten hier von Produktionsdruck und standardisierten Abläufen („McDonaldisierung“), was präventive Tätigkeiten erschweren kann, da diese zeitaufwendig sind und kurzfristig keinen hohen Umsatz generieren. Stattdessen liege der Fokus oft auf umsatzstarken Prozeduren und Verkauf von Zusatzleistungen (Bleaching, hochwertiger Zahnersatz etc.) . Auch Werbung und Marketing der Dentalindustrie beeinflussen Patientenwünsche (etwa Ästhetik-Angebote), was in Praxen wiederum Behandlungen triggert, die nicht primär medizinisch notwendig sind . Die Ethikdiskussion innerhalb der Profession läuft daher heiß: Über- oder Fehlversorgung aus finanziellen Motiven vs. patientenzentrierte Prävention. Fachgesellschaften wie die DGZMK mahnen eine De-Ökonomisierung an und haben Initiativen wie einen „Zahnärzte-Kodex“ angestoßen, um berufsethische Leitplanken gegen rein kommerzielle Triebkräfte zu setzen .
Fazit: Kommerzielle Akteure haben die Zahnmedizin historisch und gegenwärtig stark geprägt. Industrieinteressen tendieren dazu, Interventionen und Produktnutzung zu begünstigen, während nicht-kommerzielle Prävention weniger gefördert wird. Dies erfordert Gegenmaßnahmen: stringente Transparenz und COI-Regeln, unabhängige Forschung (z. B. öffentlich finanziert) zu Präventionsstrategien sowie bewusste Steuerung der Versorgung (etwa keine rein gewinnorientierten Anreizsysteme). Nur so lässt sich verhindern, dass finanzstarke Branchen – ob Zucker oder Dentalprodukte – die Richtung der Mundgesundheitsforschung und -versorgung einseitig bestimmen .
Ausbildung und berufspolitische Weichenstellungen
Wie Zahnärzte ausgebildet werden und wie ihr Berufsbild definiert ist, hat erheblichen Einfluss darauf, ob Prävention im Praxisalltag umgesetzt wird. Traditionell war die zahnärztliche Ausbildung in vielen Ländern stark technisch-prozedural geprägt: Studierende lernen vor allem, Karies zu bohren, Zähne zu füllen oder zu ersetzen, während Prävention und Gesundheitsförderung weniger curricularen Raum einnahmen. Diese Ausrichtung spiegelt sich in den Aussagen praktizierender Zahnärzte wider. In einer europäischen Interviewstudie (UK, Dänemark, Niederlande, Ungarn) gaben viele Zahnärzte zu Protokoll, dass ihre Ausbildung sie primär auf kurative Maßnahmen vorbereitet hat – ein Wechsel zu mehr Prävention fiel ihnen „schwer“ . Insbesondere fühlten sich einige unzureichend befähigt, effektive Präventionsberatung durchzuführen . Die Zahnmedizin war lange eher „reparative Handwerkskunst“ als Präventionswissenschaft.
Positiv ist, dass inzwischen ein Umdenken eingesetzt hat. Curricula werden überarbeitet, Präventivzahnmedizin, Public-Health-Zahnheilkunde und Verhaltenswissenschaften erhalten mehr Gewicht. Doch national gibt es Unterschiede: In Skandinavien wurde bereits in den 1970ern die Bedeutung der Gruppenprophylaxe erkannt, und die Ausbildung integrierte früh Konzepte wie regelmäßige Fluoridierung, Fissurenversiegelung und Ernährungslenkung. Japan hingegen hat traditionell eine Trennung: Die meisten Zahnärzte sind in kurativer Praxis tätig, während Dentalhygieniker(innen) (mit kürzerer Ausbildung) Prävention übernehmen – allerdings ist deren Rolle gesellschaftlich weniger etabliert als z. B. die der schwedischen „Tandhygienist“. In Deutschland wurde Prophylaxe als universitärer Lehrstuhl erst spät etabliert (z. T. als Schwerpunkt „Präventive Zahnheilkunde“ innerhalb der Kariologie/Parodontologie). Das Positionspapier „Zahnmedizin 2030“ der DGZMK fordert explizit, das Studium an Prävention als oberstes Gebot auszurichten . Der angehende Zahnarzt soll demnach nicht mehr primär als „Reparateur“ sozialisiert werden, sondern als **„Mundgesundheits-Coach“, der Patienten hilft, gesund zu bleiben statt immer wieder krank zu werden . Dazu gehört auch eine stärkere horizontale Vernetzung mit der Humanmedizin im Studium und die Vermittlung von Kompetenzen in Patientenmotivation und Verhaltensänderung .
Berufspolitisch spielt die Aufgabenteilung im Team ebenfalls eine Rolle. In Ländern mit gut integrierten Dentalhygienikern (z. B. USA, Kanada, Niederlande, Schweiz) werden präventive Routineleistungen (Zahnreinigung, Versiegelungen, Aufklärung) oft an diese Fachkräfte delegiert, während Zahnärzte Kapazität für komplexe Fälle haben. Wo solche Modelle fehlen oder rechtlich eingeschränkt sind (z. B. Deutschland, wo Dentalhygienikerinnen erst seit den 2000ern vermehrt ausgebildet werden und nur unter Aufsicht arbeiten dürfen), liegt die Präventionsarbeit voll auf den Schultern des Zahnarztes – der im hektischen Praxisalltag dafür oft kaum Zeit einplant. Die Standespolitik beeinflusst dies: So gab es in der Vergangenheit Widerstände mancher Zahnärzteverbände gegen eine zu große Autonomie von Hygienikern oder Therapeuten, teils aus Sorge vor Konkurrenz. Dies hat stellenweise die Etablierung präventionsorientierter Teammodelle gebremst.
Ein weiterer Aspekt ist die Vergütung in Ausbildung und Forschung: Hightech und Spezialdisziplinen (Implantologie, Kieferorthopädie) sind lukrativ und ziehen viele Talente an, während Public-Health-Zahnmedizin weniger Glamour besitzt. Dies kann dazu führen, dass weniger Nachwuchs in Präventionsforschung und -versorgung geht, wenn die Karriereperspektiven dort unattraktiv scheinen. Einige Länder steuern gegen, z. B. durch Stipendien für Community Dentistry oder die Integration von Präventionsprojekten in die Pflichtweiterbildung.
Letztlich ist ein Kulturwandel im Gange: Zahnärzte sollen zu „Oral Physicians“ werden, die ganzheitlich denken. Das bedeutet: nicht nur Bohrer und Füller zu beherrschen, sondern auch epidemiologische Zusammenhänge, Risikofaktoren und Gesundheitskommunikation. Fachleute fordern, dass jede zahnärztliche Handlung von dem Leitgedanken begleitet sein muss, neue Krankheit zu verhindern statt nur bestehende zu behandeln . Dazu müssen Ausbildung, Leitlinien und Berufspolitik Hand in Hand gehen. Die Praxis zeigt aber, dass selbst gut gemeinte Leitlinien ohne Systemänderung wenig bewirken: In Großbritannien gibt es etwa den evidenzbasierten Präventions-Leitfaden „Delivering Better Oral Health“ (Public Health England), doch viele Zahnärzte klagen, dass Zeit- und Budgetdruck die vollständige Umsetzung erschwert. Hier verbinden sich also Aus- und Weiterbildungsfragen mit den oben genannten Finanzierungsproblemen.
Kernaussage: Die Ausbildung prägt die berufliche Identität. Historisch auf Therapie gedrillt, tun sich Zahnärzte oft schwer, Prävention als integralen Teil ihrer Rolle zu sehen . Verbesserte Curricula, Fortbildungen (z. B. in Motivationskommunikation) und ein klarer berufspolitischer Rückhalt für präventives Handeln sind nötig, damit der Mundgesundheits-„Coach“ nicht bloß Vision bleibt . Es gilt, die nächste Generation von Zahnärzten mit der Haltung auszustatten, dass erfolgreiche Prävention genauso zählt wie eine perfekte Füllung – denn an letzterer besteht im Idealfall gar kein Bedarf mehr.
Patientenverhalten und Gesundheitskompetenz
Nicht zuletzt bestimmen die Patienten selbst, wie präventiv oder reaktiv ein Versorgungssystem arbeitet. Patientenverhalten und orale Gesundheitskompetenz (Health Literacy) sind Schlüsselfaktoren dafür, ob Präventionsangebote genutzt werden und Empfehlungen greifen. Mehrere Studien zeigen, dass eine höhere orale Gesundheitskompetenz mit besseren Mundhygiene-Gewohnheiten und regelmäßiger Vorsorge einhergeht, während geringe Health Literacy oft mit seltenen Zahnarztbesuchen und höherer Karieslast korreliert . Einfach gesagt: Wer versteht, warum Prävention wichtig ist und wie man sie umsetzt, hat gesündere Zähne.
In der Realität der Industrieländer gibt es jedoch weite Streuungen im Patientenverhalten. Ein verbreitetes Muster ist der „SOS-Zahnarztbesuch“: Viele Menschen – insbesondere aus sozial benachteiligten Gruppen – suchen erst bei akuten Zahnschmerzen oder sichtbaren Problemen den Zahnarzt auf, anstatt regelmäßig zur Kontrolle zu gehen. Dies wurde z. B. für Japan belegt, wo trotz universeller Versicherung nur ~1/3 der Erwachsenen im Jahr zur Prävention gehen . Zeitmangel, Kostenbeteiligungen, Zahnarztangst oder schlicht Unwissen halten Patienten davon ab, Vorsorge ernst zu nehmen. Selbst in Deutschland nimmt trotz Versicherung nur etwa die Hälfte der Versicherten konsequent jährlich ihre Vorsorgeuntersuchung wahr (was sich allerdings langsam verbessert, auch dank Bonusregelungen).
Ein weiteres Problem ist mangelnde Compliance mit präventiven Ratschlägen. Zahnärzte berichten länderübergreifend von Frustration, wenn es darum geht, Patienten zu Verhaltensänderungen zu motivieren . In Fokusgruppen zeichneten Zahnärzte das Bild, dass viele Patienten zwar zuhören, aber daheim die Empfehlungen (z. B. bessere Mundhygiene, zuckerarme Ernährung, Raucherentwöhnung) nicht umsetzen . Dieser fehlende „Return“ auf investierte Beratungszeit entmutigt manche Behandler, überhaupt ausführlich präventiv zu beraten – ein Teufelskreis. So gaben Zahnärzte in allen untersuchten Ländern an, dass schlechte Patientenmotive sie davon abhalten, immer wieder dieselbe Präventionsberatung zu leisten, da keine unmittelbaren Erfolgserlebnisse sichtbar sind . Präventionserfolge (z. B. kein neuer Kariesbefall) bleiben oft unsichtbar, während eine Füllung sofort „Problem gelöst“ signalisiert – so fehlt positiv verstärkendes Feedback für präventives Verhalten bei beiden, Patient und Zahnarzt .
Zudem herrscht teils Unklarheit darüber, wer für Prävention „zuständig“ ist. Patienten neigen dazu anzunehmen, Prophylaxe sei primär Aufgabe des Zahnarztes, während Zahnärzte betonen, letztlich liege die Verantwortung beim Patienten selbst (Stichwort: häusliche Mundpflege) . Dieses gegenseitige Zuschieben der Verantwortung („Whose Responsibility Is It Anyway?“ ) kann dazu führen, dass Prävention zwischen den Stühlen bleibt: Der Patient wartet auf Anweisung, der Zahnarzt auf Mitarbeit. Hier kommt Vertrauen und Kommunikation ins Spiel: Patienten müssen ihren Behandlern vertrauen, dass präventive Empfehlungen wichtig sind, und Zahnärzte müssen Vertrauen darin entwickeln, dass Patienten Veränderungen schaffen können. In einigen Ländern – z. B. UK – wurde festgestellt, dass Misstrauen und gegenseitige Vorurteile zwischen Stakeholdern (Patienten vs. Zahnärzte vs. Kassen) die Zusammenarbeit in Prävention erschweren . Abbau solcher Barrieren erfordert eine partnerschaftliche Kultur: gemeinsame Zielsetzung („wir wollen Ihr Gebiss gesund halten“) statt paternalistischer oder rein problembezogener Interaktion.
Sozioökonomische Faktoren spielen ebenfalls hinein. Geringes Einkommen und Bildung gehen oft mit niedriger Gesundheitskompetenz einher. So fand die japanische Studie, dass in unteren Einkommensgruppen signifikant weniger Prävention in Anspruch genommen wird, während kurative Besuche über alle Einkommen ähnlich häufig waren . Mit steigendem Einkommen stieg die Wahrscheinlichkeit für jährliche Zahnreinigungen um den Faktor 1,8 . Ähnliche Gradienten sieht man auch in westlichen Ländern: So hatten z. B. in Schottland Anfang der 2000er 5‑Jährige aus sozioökonomisch schwachen Regionen ein Vielfaches an Karieserfahrung gegenüber jenen aus besser gestellten Familien, was sich erst durch gezielte Präventionsprogramme (Childsmile) allmählich nivellierte. Kulturelle Gewohnheiten (z. B. hoher Zuckerkonsum in Form von Softdrinks, oder die Einstellung „Zahnverlust im Alter ist normal“) beeinflussen ebenfalls, inwieweit Prävention als notwendig empfunden wird.
Im Ergebnis muss Prävention auch „verkauft“ werden – nicht monetär, sondern kommunikativ. Patienten müssen motiviert und befähigt werden, eine aktive Rolle zu übernehmen. Erfolgsmodelle setzten hier an: etwa Ernährungslenkung im Kindergarten, elterliche Aufklärung schon ab der Schwangerschaft, Bonus- und Erinnerungssysteme für Check-ups, und allgemein Steigerung der Gesundheitskompetenz durch Bildungsarbeit. Solche Ansätze zeigen Wirkung: Wo z. B. in Schulprogrammen Kindern richtiges Zähneputzen täglich beigebracht wird (wie flächendeckend in Schottlands Kindergärten seit Childsmile), sinkt die Kariesrate messbar und die Akzeptanz präventiver Maßnahmen steigt – Eltern erwarten dann quasi Fluoridlack und Beratung als selbstverständlichen Teil der Betreuung .
Zusammengefasst: Patientenverhalten kann Prävention fördern oder bremsen. Derzeit ist es oft ein Hemmschuh, weil viele erst reagieren, wenn es weh tut, und präventive Ratschläge im Alltag versanden. Hier bedarf es einer Stärkung der oralen Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung und eines besseren Zusammenwirkens von Behandlern und Patienten. Gelingt es, Patienten als Partner zu gewinnen – die ihren Part (Mundhygiene, Zahnarztbesuche, Lebensstil) bewusst leisten – wird sich der Schwerpunkt natürlicherweise von der Reparatur hin zur Erhaltung verschieben.
Internationale Unterschiede und Erfolgsmodelle einer präventionsorientierten Zahnmedizin
Ein Blick auf verschiedene Industrieländer verdeutlicht, dass es durchaus erfolgreiche präventionsorientierte Ansätze gibt – deren Umsetzung aber vom jeweiligen System und Kontext abhängt. Im Folgenden einige markante Beispiele und Vergleiche:
- Skandinavien (z. B. Dänemark, Schweden, Norwegen): Diese Länder gelten als Vorreiter der Gruppenprophylaxe. Nach extrem hoher Kariesprävalenz Mitte des 20. Jh. (post-WWII) wurden hier ab den 1960er/70er Jahren umfassende Präventionsprogramme eingeführt. Öffentliche Zahnkliniken betreuen alle Kinder/Jugendlichen mit regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, Fluoridlackierungen, Fissurenversiegelungen und Gesundheitsbelehrungen – kostenlos finanziert über Steuern oder Pflichtversicherung . Ergebnis: ein dramatischer Kariesrückgang. Skandinavische 12‑Jährige reduzierten ihren Kariesindex (DMFT) bis 1990 auf teils <2, obwohl er in den 60ern noch im zweistelligen Bereich lag. In Dänemark sank z. B. der Anteil 5‑Jähriger mit Karies von ~80 % (1970) auf ~25 % (2000) . Eine Analyse skandinavischer Daten führt diese Verbesserung auf die systematische Anwendung präventiver Maßnahmen und veränderte Behandlungskonzepte zurück : Es wurde von „radikal“ (Ziehen/Bohren) auf minimalinvasive und präventive Strategien umgestellt. Interessant ist, dass trotz unterschiedlicher Herangehensweisen (Schweden betont Ernährungsberatung, Dänemark mehr Mundhygiene, Norwegen Fluorid – jeweils kulturell geprägt ) die Kinderzahn-Gesundheit heute in allen nordischen Ländern ähnlich gut ist . Lehrstück: Viele Wege führen nach Rom, entscheidend ist, dass ein umfassendes Präventionsnetz alle erreichen und kontinuierlich angewandt wird. Skandinavien zeigt auch, dass Zahnärzte im öffentlichen Dienst als Gehaltsempfänger tendenziell präventionsorientierter arbeiten können, da sie nicht vom einzelnen Eingriff profitieren müssen.
- Deutschland: Die Bundesrepublik hat in den letzten Jahrzehnten signifikante Präventionsfortschritte gemacht (z. B. Kariesreduktion bei Kindern um ~80 % seit 1990). Erfolgsmodell ist hier v. a. die gruppenprophylaktische Betreuung in Kindergarten und Grundschule (Aktion Zahngesundheit) sowie Individualprophylaxe-Leistungen für Kinder/Jugendliche (Fluoridlack, Fissurenversiegelung, alle 6 Monate, Kassenleistung). Diese Maßnahmen zeigen Wirkung: 12‑Jährige haben im Schnitt <0,5 bleibende Zähne kariös (DMFT ~0,5). Allerdings besteht im Erwachsenenbereich weiter Nachholbedarf: Parodontalerkrankungen und Karies bei Senioren sind nach wie vor verbreitet. Das System krankt an den erwähnten Fehlanreizen (FFS) und einer historisch kurativ geprägten Praxisstruktur (Einzelpraxen, wenig öffentliche Zentren). Prävention bei Erwachsenen (z. B. PZR) ist privat zu zahlen, was die Inanspruchnahme limitiert. International gilt Deutschland trotz guter Kinderzähne nicht als Musterknabe der Prävention, da die Kosten immer noch stark durch restaurative und prothetische Versorgungen dominiert werden . Positiv hervorzuheben ist aber die starke Rolle der Krankenkassen in Aufklärung (Bonusheft, Prophylaxekampagnen) und die wissenschaftliche Fundierung – deutsche Fachgesellschaften veröffentlichen Leitlinien zur Kariesprävention, zur Fluoridanwendung etc., was die Versorgung evidenzbasierter macht. Mit dem demografischen Wandel (alternde Bevölkerung) steht Deutschland vor der Aufgabe, Prävention auch für Senioren zu etablieren (Stichwort: Alterszahnheilkunde, z. B. präventive Betreuung in Pflegeheimen).
- Großbritannien (UK): Das britische Beispiel ist ambivalent. Einerseits hat das steuerfinanzierte NHS-System lange mit begrenzten Ressourcen gekämpft, was in der Vergangenheit zu einem rein reparativen „dental treadmill“ führte (Zahnärzte wurden nach Menge der gefüllten/gezogenen Zähne bezahlt, Prävention spielte kaum eine Rolle). Andererseits hat Schottland mit „Childsmile“ ab 2006 ein international beachtetes Präventionsprogramm etabliert: Kostenloses Zahnpflegepaket für Familien ab Geburt, intensives gemeinschaftsbasiertes Zähneputzen im Kindergarten, regelmäßige Fluoridlacke für Risikokinder, Vernetzung von Gesundheitsdienstleistern. Resultat: In 10 Jahren sank die Kariesprävalenz bei 5‑Jährigen deutlich, vor allem in sozioökonomisch benachteiligten Regionen . England und Wales haben ähnliche Ansätze (z. B. „Designed to Smile“ in Wales). Trotzdem bleibt der NHS-Zahnsektor unter Druck: Präventionsleistungen werden zwar in Richtlinien gefordert, aber durch das Zielsystem (bestimmte Anzahl „Units“ pro Jahr) nur begrenzt honoriert. Viele Briten weichen auf private Zahnreinigungen aus oder bekommen in der NHS-Praxis eher schnelle Füllungen als ausführliche Beratungen – schlicht weil die Zeit knapp und das Budget gedeckelt ist. Als Erfolgsmodell kann man UKs Public-Health-Integration werten: Zahnärzte arbeiten mit Schulen, Hebammen, Hausärzten zusammen, um präventive Botschaften zu verbreiten (z. B. „Lift the Lip“-Checks bei Kleinkindern durch Kinderärzte). Diese Verzahnung der Prävention in Primärversorgung und Erziehung ist beispielhaft.
- USA: Ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite Spitzenforschung und hochmoderne Privatkliniken, auf der anderen Seite große Bevölkerungsgruppen ohne ausreichende Versorgung. Die Wasserfluoridierung, eine der wirksamsten bevölkerungsweiten Kariespräventionsmaßnahmen, wurde in den USA bereits ab 1945 eingeführt und erreicht heute ~2/3 der Bevölkerung – ein entscheidender Grund, warum Karies bei US-Kindern tendenziell abnahm. Auch private Versicherer fördern Prävention (meist 100 %-Abdeckung für halbjährliche Untersuchungen/Reinigungen). Auf systemischer Ebene fehlt jedoch ein kohärentes, für alle zugängliches Präventionskonzept. Medicaid (staatliche Versicherung für Einkommensschwache) deckt bei Kindern zwar zahnmedizinische Leistungen, aber die Inanspruchnahme ist niedrig und oft kurativ orientiert. Erfolgsmodelle findet man in integrierten Gesundheitssystemen: z. B. Kaiser Permanente in Kalifornien hat zahnmedizinische Programme, die präventive Betreuung belohnen, oder Community Dental Clinics, die mit Bundessubvention präventionsorientiert arbeiten (z. B. Schulzahnpflege in sozialen Brennpunkten). Innovationen wie Caries Management by Risk Assessment (CAMBRA) – ein individualisiertes Präventionsprotokoll – wurden in den USA entwickelt und zeigen in Pilotstudien deutliche Kariesreduktionen, wenn konsequent angewandt. Allerdings bleiben diese Ansätze Inseln in einem Ozean von vorwiegend einzelfallorientierter Privatmedizin. Bemerkenswert ist das Aufkommen von Direct-to-consumer-Prophylaxe (Apps, Abo-Modelle für Mundhygieneprodukte, Fluoridlack im Selbstauftrag), was die klassische Zahnarztrolle ergänzen könnte.
- Japan: Wie oben beschrieben, hat Japan ein paradoxes System: sehr gute Zugänglichkeit zu Behandlung dank Versicherung, aber Prävention ist „Privatsache“ (bzw. Sache der Gemeinden). Einige Gemeinden bieten kostenlose Check-ups für bestimmte Altersgruppen (z. B. Einschulungsuntersuchung, Seniorenkontrollen), doch es fehlt ein landesweites kohärentes Präventionsprogramm. Interessanterweise ist die Mundgesundheit der Japaner dennoch relativ gut – z. B. haben 12‑Jährige im Schnitt ~1 DMFT, was vergleichbar mit Westeuropa ist. Dies wird teils der starken Schulzahnpflege in der Nachkriegszeit zugeschrieben und einer relativ zahnbewussten Kultur (häufige Zahnbürstenwechsel, Verbreitung von Mundspülungen etc.). Dennoch kritisieren Forscher, dass Japan mehr tun könnte, um Prävention zu stärken und regionale Ungleichheiten zu mindern . Erfolgsmodell in Japan ist die regelmäßige zahnärztliche Reihenuntersuchung: Ab Kindergarten bis Highschool führen Schulzahnärzte jährliche Screenings durch und schicken bei Bedarf Behandlungsempfehlungen an die Eltern. Dadurch werden Probleme früh erkannt – allerdings bleibt die tatsächliche präventive Intervention (z. B. Versiegelung) dem privaten Zahnarzt überlassen.
Zusammenfassung internationaler Insights: Länder mit öffentlich organisiertem, universellem Zugang zur Zahnvorsorge (z. B. Skandinavien, Schottland) zeigen die besten Präventionserfolge, insbesondere bei Kindern . Systeme, die hingegen auf Privatinitiative setzen (USA, teils Japan), haben größere Lücken in der Präventionsabdeckung – hier sind Präventionsleistungen oft einkommensabhängig in Anspruchnahme . Deutschland liegt dazwischen: Breite Versicherung, aber systemische Fehlanreize. Wichtig ist: Kein System ist perfekt, aber erfolgreiche Modelle kombinieren mehrere Faktoren – finanzielle Präventionsanreize, flächendeckende Programme, interdisziplinäre Zusammenarbeit, hohe Gesundheitskompetenz – und passen diese den lokalen Gegebenheiten an. Präventionsorientierte Zahnmedizin ist also machbar, wenn man sie politisch will und strukturell verankert.
Studienbewertung und Autoren-Transparenz (Ampelsystem)
Zum Abschluss erfolgt eine Bewertung der wichtigsten herangezogenen Studien und Quellen hinsichtlich ihrer Evidenzqualität, Unabhängigkeit und Transparenz. (Grün = hohe Qualität/geringes Bias-Risiko; Gelb = moderate Qualität/gewisse Limitationen; Rot = niedrige Qualität/hohes Bias-Risiko):
- Watt et al., Lancet (2019) – 🟢 Grün: Umfassende Review-Kommission (The Lancet Series) mit international renommierten Experten (UCL, WHO-Zentren etc.). Kritische Bestandsaufnahme der globalen Zahnmedizin, gestützt auf zahlreiche Studien. Kein Interessenkonflikt erkennbar; im Gegenteil beleuchtet die Arbeit industriebedingte Bias und fordert mehr Transparenz . Methodisch ein Narrative Review mit Policy-Empfehlungen – keine neue Primärstudie, aber hoher Evidenzwert durch Expertenkonsens und breiten Literaturbezug. Fazit: Hochwertige, unabhängige Quelle mit großer Aussagekraft für systemische Probleme.
- Cochrane-Review (Eaton et al., ~2013) zu Vergütungsmodellen – 🟡 Gelb: Systematisches Review von zwei RCTs in UK, untersucht FFS vs. Capitation . Methodisch Cochrane-Standard (sehr robust), aber Evidenz limitiert durch wenige Studien; Ergebnisse nur bedingt generalisierbar (UK Primary Care Setting). Kein Bias erkennbar (unabhängig finanziert, transparente Methodik). Eingestuft als gelb, da die Aussagekraft eingeschränkt ist (Qualität der Evidenz wurde als niedrig bewertet) – es besteht weiterer Forschungsbedarf. Dennoch wertvoll als einziger vorhandener Review zum Thema, mit impliziter Policy-Relevanz.
- Leggett et al., JDR Clin Trans Res (2021) – 🟢 Grün: Qualitative Mehrländer-Studie (ADVOCATE-Projekt, EU H2020-Funding) über Barrieren zur Prävention in 6 europäischen Ländern . Solide Durchführung (58 Interviews, 13 Fokusgruppen, deduktive Thematic Analysis) mit angemessener Stichprobe (n=149 Stakeholder) . Unabhängige Finanzierung (EU) und klarer COI-Hinweis: keine Konflikte. Ergebnisse sehr relevant, decken multiple Themen ab (Regulierung, Finanzierung, Wissen, Vertrauen, Patientenfaktoren) . Minor Caveat: als qualitative Studie keine quantifizierbaren Effekte, aber tiefe Einblicke. Autoren (Leeds Univ. und Partner) erscheinen transparent, Publikation in Peer-Reviewed Journal. Bewertung: Grün – hohe Glaubwürdigkeit und wertvolle praxisnahe Erkenntnisse.
- Kearns et al., PLOS Medicine (2015) – 🟢 Grün: Historische Dokumentenanalyse („Sugar Papers“) zur Einflussnahme der Zuckerindustrie auf die Kariesforschung . Sehr gut dokumentiert, Primärquellen aus Archiven, veröffentlicht in einem Top-Journal (PLOS Med) mit strenger Peer Review. Autoren (UCSF) sind ausgewiesene Experten für Industrie-/COI-Forschung (u. a. Stanton Glantz). Interessenkonflikte: keine (eher im Gegenteil entlarvt die Studie fremde COI). Methodisch qualitativ (Aktenstudie), aber deduktiv-analytisch mit hoher Validität. Ergebnis hat direkte Policy-Implikationen. Bewertung: Grün – liefert einzigartigen, glaubwürdigen Nachweis für systemischen Bias.
- Murakami et al., BMC Oral Health (2014) – 🟢 Grün: Querschnittsstudie zu Nutzung präventiver vs. kurativer Zahnversorgung in Japan . Große Stichprobe (n=4.357 Erwachsene) , repräsentativ für urbane Bevölkerung 25–50 Jahre. Ergebnisse statistisch robust (soziale Gradienten in Präventionsnutzung signifikant). Open Access, Peer-reviewed. Finanzierung vermutlich akademisch (Autoren von Univ. Tokyo, keine COI im Artikel angegeben). Limitation: Querschnittdesign zeigt Assoziationen, keine Kausalität – aber die Fragestellung eignet sich dafür. Bewertung: Grün – gute Evidenz zur Verhaltenskomponente, methodisch solide.
- McAuliffe et al., BMC Oral Health (2025) – 🟢 Grün: Intercountry Policy Analysis („Tipping Point“) zu Kinder-Zahnversorgung in 6 EU-Ländern . Mixed-Methods (Dokumentenanalyse + Experteninterviews), multiple Cases (DK, DE, HU, IE, SCO, ES). Publikation sehr aktuell (2025) im begutachteten Journal. Autoren: Public Health-Forscher (Dublin/Cork, etc.), vermutlich unabhängige akademische Studie; Finanzierung nicht explizit genannt, aber kein Anzeichen von Industry Bias. Ergebnisse belastbar, da trianguliert (Übereinstimmung von Dokumenten und Expertenaussagen). Interessenkonflikt: keiner angegeben. Bewertung: Grün – aktuelle, valide Quelle für Systemvergleich und Bedeutung universeller Prävention.
- DGZMK-Positionspapier „Perspektive 2030“ (2020) – 🟡 Gelb: Positionspapier einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft (Deutschland) . Keine originäre Studie, sondern Konsensdokument führender Universitätszahnmediziner. Enthält evidenzbasierte Empfehlungen (mit Literatur untermauert, Referenzen [3,4] etc.), aber auch berufs- und standespolitische Anliegen. Transparenz: Autoren sind nicht einzeln genannt, sprechen fürs Kollektiv (DGZMK); potenzielle Interessenkonflikte werden nicht explizit aufgeführt – jedoch ist bei einem solchen Papier davon auszugehen, dass primär wissenschaftliche Motive dahinterstehen (gleichwohl könnten standespolitische Interessen einen Bias darstellen, z. B. Betonung universitärer Zahnmedizin etc.). Methodisch kein neutraler Review, sondern Expertenmeinung. Dennoch wertvoll, da es die Selbstreflexion der Profession zeigt (Eingeständnis, dass noch zu viel repariert wird und Aufruf zur Präventionsorientierung). Bewertung: Gelb – inhaltlich vertrauenswürdig und im Einklang mit unabhängiger Evidenz, aber eben ein Positionspapier (Level 5-Evidenz).
- Dental Economics Artikel (2020) zu FFS vs. Capitation – 🟡 Gelb: Branchen-Editorial eines erfahrenen Zahnarztes, das die Anreize beider Vergütungsmodelle erläutert . Kein Forschungsartikel, aber deckungsgleich mit der Literatur: FFS = Overtreatment-Risiko, Capitation = Undertreatment-Risiko. Leichtes Bias möglich, da subjektive Sicht (der Autor versucht allerdings, ausgewogen zu sein, mit beiden „dunklen Seiten“). Keine formalen COI angegeben, vermutlich unabhängig (Dental Economics erhält aber Anzeigen von Versicherungen – indirekter Bias nicht auszuschließen). Nutzung hier primär zur Veranschaulichung, nicht als Evidenzquelle. Bewertung: Gelb – informativer Praxisbericht, jedoch nicht peer-reviewed.
(Keine Rot-Einstufungen bei den verwendeten Quellen: Es wurden bewusst überwiegend unabhängige, qualitativ hochwertige Studien und Reviews herangezogen. Potenziell bias-behaftete oder rein meinungsbasierte Quellen wurden vermieden oder kritisch eingeordnet. Ein generelles Defizit besteht darin, dass manche Aspekte (z. B. Einfluss der Dentalprodukt-Industrie auf Behandlerverhalten) kaum durch Studien abgedeckt sind – diese „Forschungslücke“ stellt ein meta-Bias dar, da mangels Daten bestimmte Schlüsse nur indirekt gezogen werden können.)
Fazit: Die Fokussierung der Zahnmedizin auf Reparaturen statt Prävention ist multifaktoriell bedingt – von Finanzierungslogik über Industrieeinflüsse bis zur Aus- und Fortbildung und dem Verhalten der Patienten. International zeigt sich: Wo finanzielle und strukturelle Voraussetzungen Prävention begünstigen, wo Akteure an einem Strang ziehen und wo hohe Gesundheitskompetenz herrscht, verschiebt sich das Gleichgewicht zugunsten der Vorbeugung. Deutschlands Zahnmedizin hat große Erfolge erzielt, hinkt aber in der Erwachsenenprävention noch hinter idealen Möglichkeiten her. Skandinavien und Modelle wie Childsmile beweisen, dass präventionsorientierte Zahnheilkunde realisierbar ist – mit politischem Willen und langfristigen Investitionen. Die nächste Generation von Studien sollte verstärkt evaluieren, wie man Vergütung, Ausbildung und Patientenmotivation neu gestalten kann, um die Vision vom „präventiven Paradigma“ wahr werden zu lassen. Denn letztlich gilt: Der beste Zahn ist der, der gar nicht erst repariert werden muss.